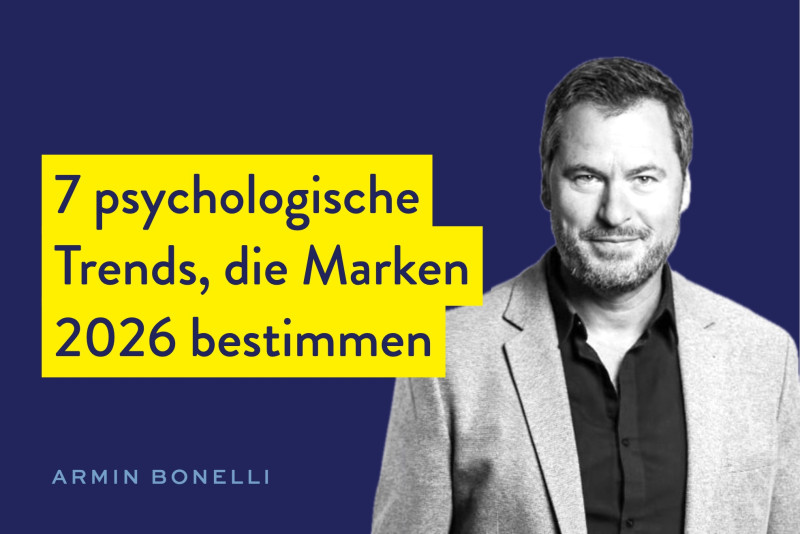Der arbeitende Kunde

Vom Service zur Selbstbedienung – warum wir als Konsumenten für Unternehmen arbeiten, die wir eigentlich für ihre Leistungen bezahlen.
![]() 13. Oktober 2025
13. Oktober 2025
![]() Lesezeit: 7 Min
Lesezeit: 7 Min
Inhalt
Kennen Sie das? Man bestellt online, verfolgt das Paket selbst, druckt das Retourenlabel aus, bringt das Päckchen zur Post – und wundert sich kaum, dass niemand einem dabei hilft. Oder man sitzt im Restaurant, scannt einen QR-Code, bestellt digital, zahlt mit Karte und trägt sein Tablett selbst weg.
An der Tankstelle sind die Kunden in meiner Kindheit im Auto sitzen geblieben. Der Tankwart besorgte das Auftanken und reinigte obendrein noch die Windschutzscheibe. „Soll ich Öl und Wasser kontrollieren?“ wurde man noch gefragt. Heute besorgen wir Konsumenten alles selbst.
Am Flughafen muss man inzwischen selbst den Koffer mit einer Banderole bekleben, und dann beim Gepäck-Checkin selbst abwägen, scannen und auf das Förderband legen. Willkommen in der Welt des arbeitenden Kunden.
Der US-amerikanische Comedian Sebastian Maniscalco beklagte 2012 in seinem Programm „What’s Wrong With People?“ die Entwicklung, dass der Kunde im Handel inzwischen selbst die Arbeit machen muss: „Sie haben uns Selbstbedienungskassen aufgestellt und gesagt: macht es doch selbst! Aber wieso arbeite ich jetzt im Supermarkt? Und niemand kennt sich aus, es herrscht totale Verwirrung. Wir wurden ja nicht an diesen Maschinen eingeschult. Die Mitarbeiter hatten dafür ein dreiwöchiges Training, aber wir müssen ohne die geringste Ahnung loslegen…“
Was früher als selbstverständliche Dienstleistung angeboten wurde, ist heute oft Selbstbedienung. Unternehmen sparen Personal, die Kundinnen und Kunden übernehmen Aufgaben, die früher Beschäftigte erledigten. Praktisch, effizient – und irgendwie seltsam. Denn je digitaler und automatisierter die Welt wird, desto mehr Arbeit wandert zu uns Konsument:innen zurück.
Der Begriff „arbeitender Kunde“
Die Soziologen Günter Voß und Kerstin Rieder haben dieses Phänomen erstmals im Jahr 2005 erforscht. Sie prägten den Begriff des „arbeitenden Kunden“ und beschreiben, wie Menschen im Rahmen von Konsumprozessen aktiv Tätigkeiten übernehmen, die zuvor Teil bezahlter Dienstleistung waren.
„Arbeit verschwindet nicht – sie wandert.“
Günter Voß
Ob beim Self-Checkout im Supermarkt, bei der Online-Flugbuchung oder beim Zusammenbauen eines IKEA-Regals – überall sind Konsumenten zu unbezahlten Mitproduzenten geworden. Sie sind keine passiven Empfänger von Leistungen mehr, sondern übernehmen aktiv Aufgaben, die früher anderen zufielen.
Das unterscheidet sie vom klassischen „Prosumer“ (Eine Kombination aus Producer und Consumer), der selbst produziert, weil er es will. Der arbeitende Kunde produziert, weil er muss – weil der Service so organisiert ist.
Wenn Service zur Selbstarbeit wird
Dass Konsumenten mitarbeiten, ist kein Zufall, sondern System. Unternehmen lagern Tätigkeiten aus, die standardisierbar sind. Statt aufwendiger Beratung gibt es FAQ-Seiten und Chatbots. Statt persönlicher Betreuung Self-Check-in-Automaten.
Diese Verlagerung spart Kosten, erhöht die Geschwindigkeit und scheint zugleich modern: Wer selbst klickt, bucht, montiert, fühlt sich unabhängig. In Wahrheit erledigen wir aber Arbeit – freiwillig, aber nicht unbedingt bewusst.
Je nach Branche hat diese Entwicklung unterschiedliche Gesichter:
- • Im Handel: Kassieren, verpacken, retournieren
- • In der Reisebranche: Online einchecken, Gepäckaufkleber drucken
- • Im digitalen Raum: Inhalte bewerten, Fehler melden, Updates durchführen
Die unsichtbare Wertschöpfung
Voß und Rieder sprechen von einer „stillen Revolution der Arbeit“. Arbeit verschwindet nicht – sie wandert. Und sie wird unsichtbar, weil sie in privaten Alltagssituationen stattfindet.
Wenn wir etwa Produkte konfigurieren, Kundenkonten pflegen oder Bewertungen schreiben, schaffen wir Wert. Wir tun es unbezahlt, oft unbewusst und manchmal sogar gern. Die Grenzen zwischen Freizeit, Konsum und Arbeit verschwimmen.
In diesem Sinne wird der Kunde zum „Arbeitskraftunternehmer“ (Voß) seiner selbst – nicht im ökonomischen, sondern im alltäglichen Sinn. Die Wertschöpfung des Unternehmens hängt immer stärker von der Mitwirkung des Kunden ab.
Zwischen Empowerment und Ausbeutung
Natürlich hat das auch positive Seiten. Viele Menschen empfinden es als angenehm, Dinge selbst in der Hand zu haben. Man kann die eigene Reise buchen, Preise vergleichen, das eigene Produkt gestalten, das eigene Konto verwalten – unabhängig von Öffnungszeiten oder Warteschleifen.
Doch es gibt eine Kehrseite: Die Verantwortung wächst. Fehler bei der Buchung? Pech gehabt. Falsche Angaben im Formular? Selbst schuld. Was früher Aufgabe des Dienstleisters war, wird zur Last des Kunden.
Damit kippt die Freiheit schnell in Überforderung. Und das führt zu einem Paradoxon: Je bequemer Systeme werden sollen, desto mehr Arbeit steckt hinter der Bequemlichkeit – allerdings nicht bei den Unternehmen, sondern bei uns Menschen.
Markenperspektive: Wenn Mitmachen Teil des Erlebnisses wird
Aus Markensicht ist der „arbeitende Kunde“ kein notwendiges Übel, sondern ein Gestaltungselement. Clevere Marken schaffen es, die Mitwirkung zum Erlebnis zu machen.
„Je freudvoller die Beteiligung, desto stärker die Markenbindung.“
Armin Bonelli
Apple zum Beispiel lässt seine Nutzer Geräte selbst einrichten – aber so elegant, dass es Freude bereitet. IKEA verkauft Möbel zum Selberbauen, aber die Marke erzählt die Geschichte vom „Do it yourself“ als Ausdruck von Lebensstil. AirBNB lässt Gastgeber und Gäste gleichwertig agieren – die Plattform lebt von dieser aktiven Rolle.
Das funktioniert gut, solange die Mitwirkung Erfolgserlebnisse bringt und positiv emotional aufgeladen ist. Sobald sie als Zwang empfunden wird oder zu kompliziert werden, kippt die Stimmung. Dann wird der arbeitende Kunde zum genervten Kunden – und das ist gefährlich für jede Marke.
Fazit
Der arbeitende Kunde ist kein Randphänomen, sondern ein Symbol unserer Zeit. Er zeigt, wie sehr sich Arbeit, Konsum und Selbstorganisation vermischen. Unternehmen profitieren davon, Kunden in ihre Prozesse einzubinden – doch sie tragen auch Verantwortung. Denn am Ende entscheidet sich Markenloyalität nicht an der Menge der Selfservice-Optionen, sondern daran, wie respektvoll eine Marke mit der Zeit und Aufmerksamkeit ihrer Kunden umgeht.
Vielleicht sollten wir uns also öfter fragen: Wenn der Kunde arbeitet – wer arbeitet hier eigentlich für wen?
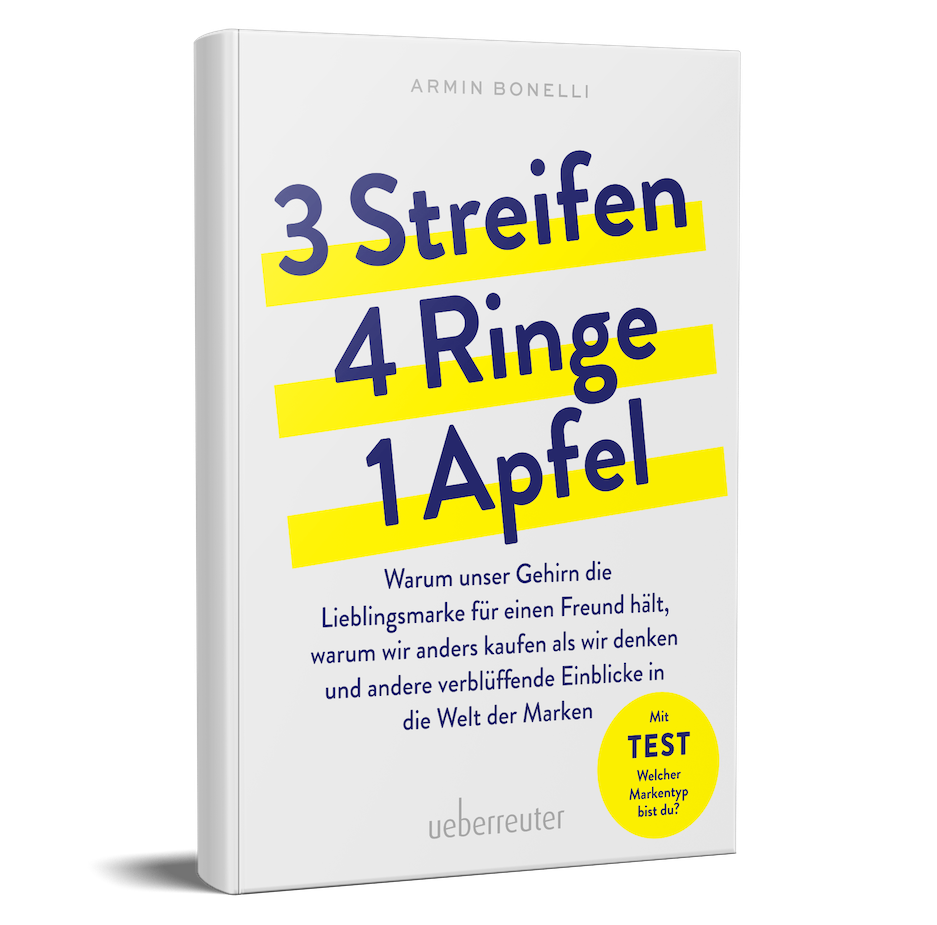
Mehr zu diesem Thema gibt es in meinem Buch. Es ist im Buchhandel und online zum Preis von 22 Euro* erhältlich.
* Unverbindliche Preisempfehlung
 Armin Bonelli
Armin Bonelli
![]() 13. Oktober 2025
13. Oktober 2025
![]() Lesezeit: 7 Min
Lesezeit: 7 Min